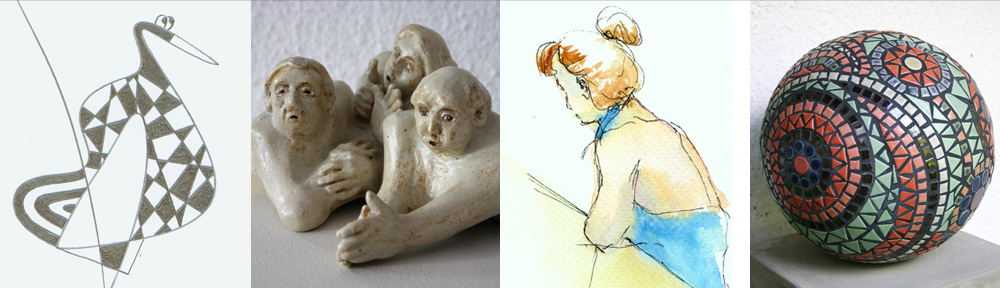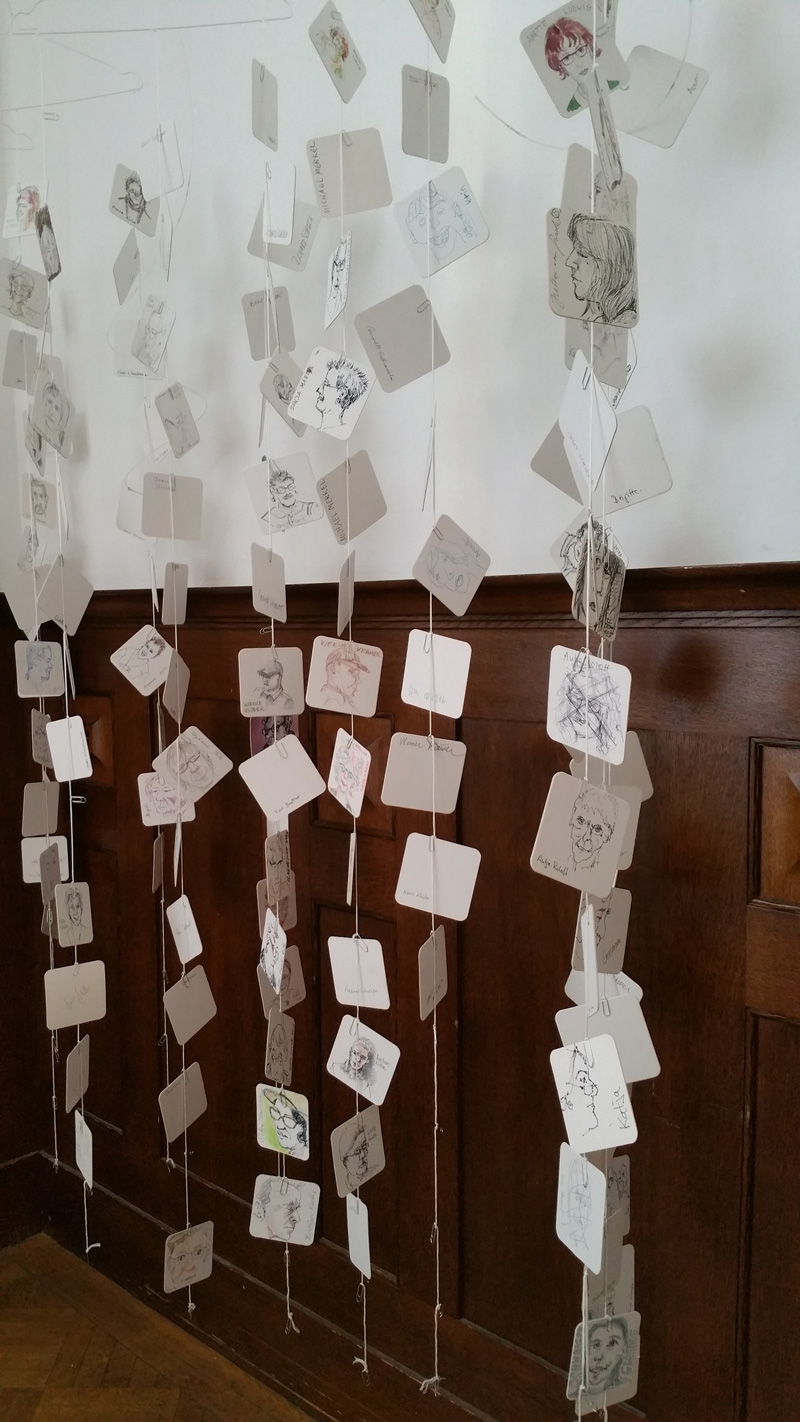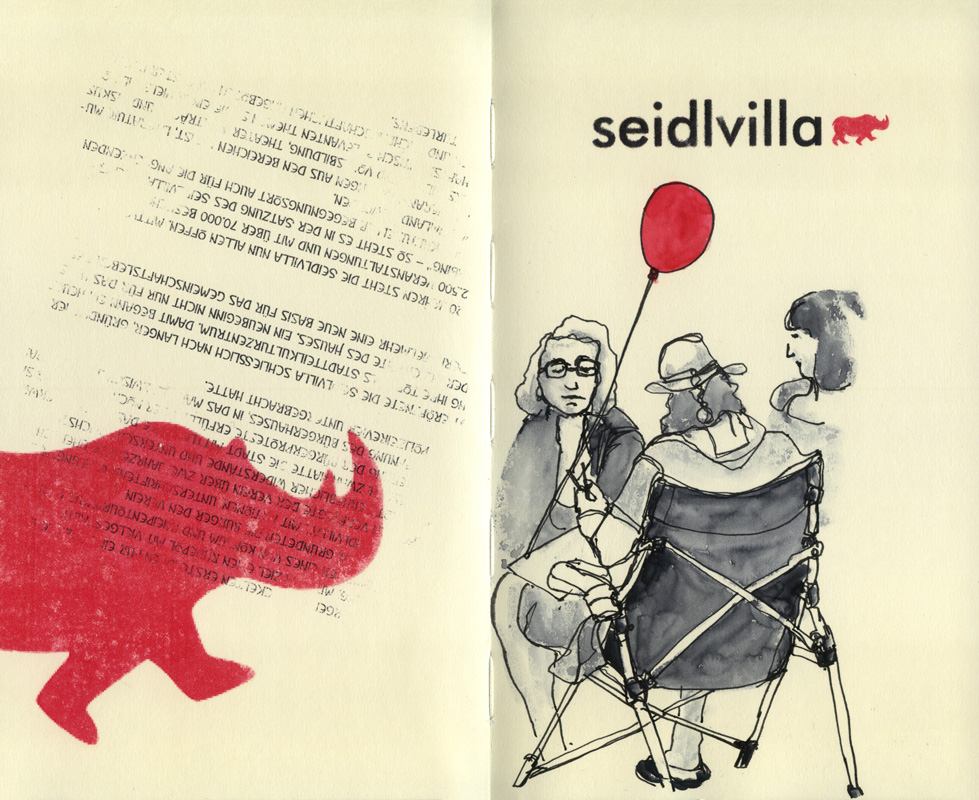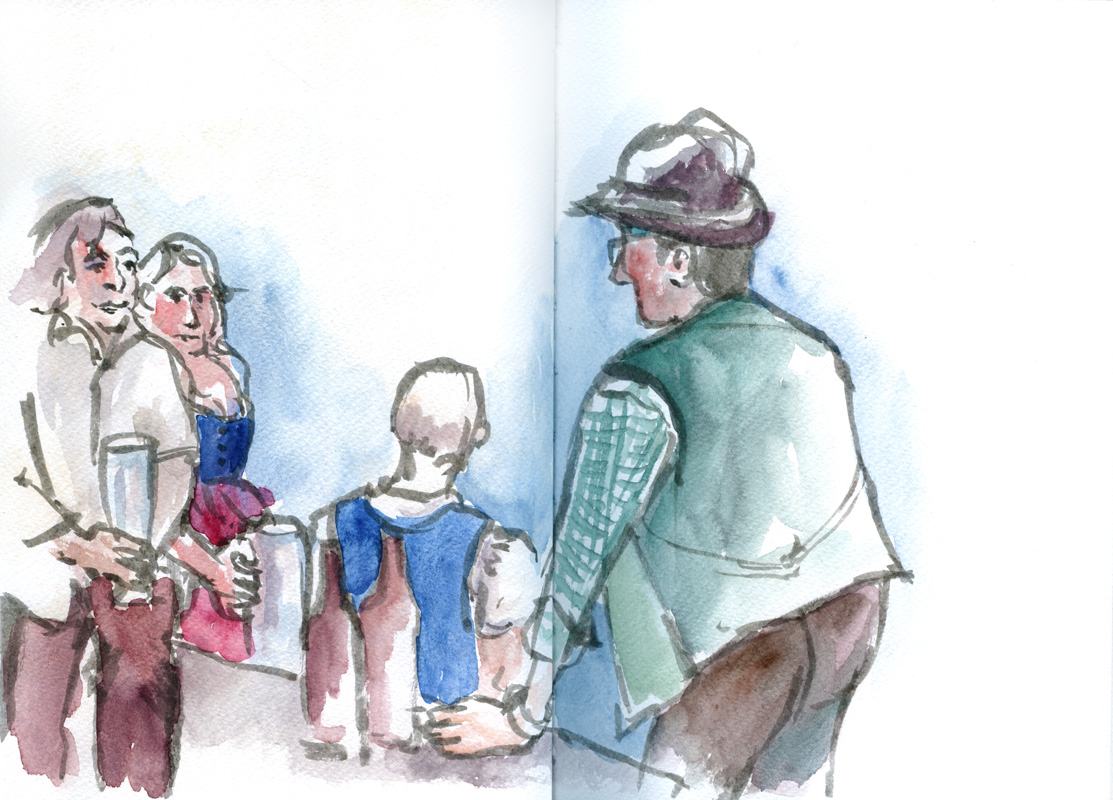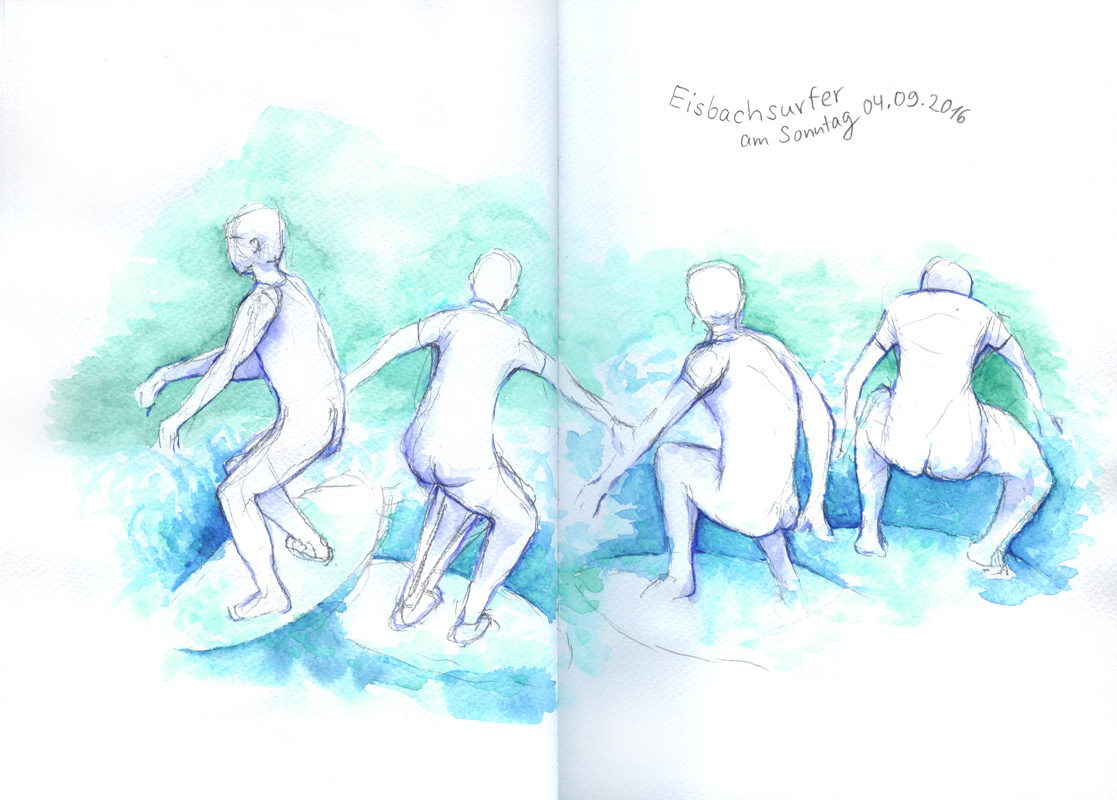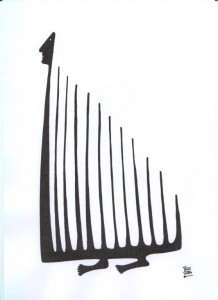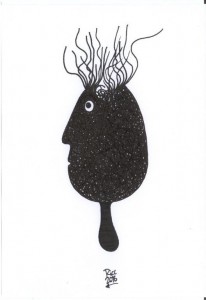Ich lese schnell und oberflächlich. Beschreibungen von Wolken und Ausschmückungen von Gefühlswallungen überlese ich.
Diesmal, in Kirchhoffs Buch „Widerfahrnis“, stoppte mich auf der zweiten Seite ein 7-Zeilen langer, genau 53-Wörter langer Satz. Ich musste diesen Satz nochmal lesen. Dadurch vergaß ich die vorher überflogenen Sätze. Ich begann, nochmal von Anfang an zu lesen, nun langsam, bis zu dem 53iger Satz.
Am besten sollte ich den Schluss der Geschichte lesen, wie ich es meist bei einem neuen Buch tue und dann entscheiden, ob ich weiterlesen soll. Ich nahm mich zusammen, ließ es sein und las weiter.
Beim nächsten Halbsatz „Dafür war man hier, im oberen Weissachtal, der Welt des müden Lächelns entkommen“, wurde das Buch für mich spannend. Ein paar Seiten weiter, lässt der Schriftsteller den Protagonist Reither, einen ehemaligen Verleger, in der „Walberg-Residenz“ und an der Straße zum Achensee wohnen.
Ich war mit Tano diesem Tal gerade entronnen. Ich war in der Terme Tuhelj, 40 km entfernt von Zagreb. Während Tano beim Schwimmen war, lag ich mit dem Buch im Bett.
Ich las, für mich ungewöhnlich, langsam. Ich blieb an wunderschönen Sätzen hängen, wie an diesem: „Sie, zuletzt Besitzerin eines Hutgeschäftes; sie hat ihren Laden geschlossen, weil es der Zeit an Hutgesichtern fehlt, und er seinen Verlag dichtgemacht, weil es zunehmend mehr Schreibende als Lesende gibt“, oder dem Satz: „Reither griff nach den Zigaretten, nicht um gleich wieder zu rauchen, um etwas in der Hand zu haben, wenn ihm schon die Worte fehlten“ oder „Raucher waren Leute, die nicht gleich reden wollten, die sich erst sammelten und dabei ihre kleine Pantomime aufführten.“
Ich blieb sogar an einzelnen Wörtern hängen: Haare hatten die Farbe von Harz, von Tabak, Asche oder Pistazienschalen.
 In der Mitte des Buches, als Reither und die ehemalige Hutgeschäftbesitzerin Leonie Palm mit dem Auto nach Sizilien fahren und Catania erreichen, wurde ich schneller im lesen. Es war unsere Reiseroute in die Heimat von Tano. Sie fuhren so lange bis die Straße zu eng wurde und hielten dort an, wo einmal unsere Unterkunft war, an der Vicolo della Lanterna.
In der Mitte des Buches, als Reither und die ehemalige Hutgeschäftbesitzerin Leonie Palm mit dem Auto nach Sizilien fahren und Catania erreichen, wurde ich schneller im lesen. Es war unsere Reiseroute in die Heimat von Tano. Sie fuhren so lange bis die Straße zu eng wurde und hielten dort an, wo einmal unsere Unterkunft war, an der Vicolo della Lanterna.
An diesem Punkt hielt ich es nicht mehr aus und blätterte zum Schlusssatz des Buches. Nur den Allerletzten lese ich, nahm ich mir fest vor, um die Spannung zu erhalten. Der Satz hatte 64 Wörter, genau 286 Buchstaben.